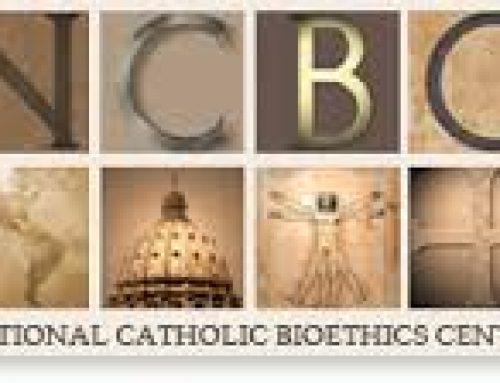Die Enzyklika „Spe salvi“ und das Menschenbild der Psychotherapie
Von Ermanno Pavesi
CHUR, 23. Januar 2008 (ZENIT.org).- Das Thema der Hoffnung im engeren Sinn hat in der Psychiatrie und in der Psychotherapie einen eher bescheidenen Platz inne. Die wichtigsten Schulen gehen von einem naturalistischen Menschenbild aus, betrachten psychische Inhalte und Tätigkeiten nicht als menschliche Handlungen, sondern als Naturereignisse, die von Naturgesetzen geregelt werden. Ein solches Menschenbild kann deshalb eher Ursachen von Ereignissen als Sinn oder telos von Handlungen kennen.
Die Enzyklika Spe salvi lehrt aber: „Nicht die Elemente des Kosmos, die Gesetze der Materie, herrschen letztlich über die Welt und über den Menschen, sondern ein persönlicher Gott herrscht über die Sterne, das heißt über das All; nicht die Gesetze der Materie und der Evolution sind die letzte Instanz, sondern Verstand, Wille, Liebe – eine Person. Und wenn wir diese Person kennen, sie uns kennt, dann ist wirklich die unerbittliche Macht der materiellen Ordnungen nicht mehr das Letzte; dann sind wir nicht Sklaven des Alls und seiner Gesetze, dann sind wir frei. Ein solches Bewußtsein hat die suchenden und lauteren Geister der Antike bestimmt. Der Himmel ist nicht leer. Das Leben ist nicht bloßes Produkt der Gesetze und des Zufalls der Materie, sondern in allem und zugleich über allem steht ein persönlicher Wille, steht Geist, der sich in Jesus als Liebe gezeigt hat“ (5).
Der Mensch kommt zur Welt mit einer erblichen Veranlagung. Die psychische Tätigkeit setzt neurobiologische Prozesse voraus. Äußere Faktoren sowohl in der frühen Kindheit – meistens durch die Familie – wie auch später – durch die Gesellschaft – prägen und beeinflussen seine Entwicklung. Der Mensch aber als Person besitzt eine Geistseele, die ihn zu einem Endziel bestimmt. Gerade dieses Endziel, welchem sämtliche kleinere und größere Ziele in seinem Leben untergeordnet werden sollen, stellt für den Menschen die große Hoffnung dar und gibt seiner Existenz Sinn. Der Mensch macht ständig die Erfahrung der eigenen Beschränktheit, der Gebrechlichkeit seines Körpers, der äußeren Konditionierungen, der unzähligen Sachzwänge und Widerwertigkeiten, und nicht zuletzt der eigenen Schwächen. Trotzdem kann die Gewissheit, doch auf dem Weg zu einem Endziel zu sein, ihm Hoffnung geben.
„Erlösung ist uns in der Weise gegeben, daß uns Hoffnung geschenkt wurde, eine verläßliche Hoffnung, von der her wir unsere Gegenwart bewältigen können: Gegenwart, auch mühsame Gegenwart, kann gelebt und angenommen werden, wenn sie auf ein Ziel zuführt und wenn wir dieses Ziels gewiß sein können; wenn dies Ziel so groß ist, daß es die Anstrengung des Weges rechtfertigt“ (Spe salvi, N. 1).
Viele Probleme, die auch immer wieder zu psychischen Schwierigkeiten oder sogar Störungen führen können, hängen gerade davon ab, dass der Mensch mit den Mühseligkeiten der Existenz nicht fertig wird, dass er kein Ziel vor Augen hat, das eine solche Last erträglich machen kann.
Es kann paradox erscheinen: Der Mensch muss immer weniger um das Überleben kämpfen, verliert aber nicht selten dabei einen der wichtigsten Gründe zum Leben. Das Leiden wird oft zu einem Problem der Analgesie reduziert, als ob das Leiden mit der Linderung der physischen Schmerzen aufhören würde: Man kann für die heutigen, hochwirksamen Schmerzmittel nicht genügend dankbar sein, die z. B. einen Krebskranken weitgehend von den Schmerzen befreien können. Diese Mittel aber, wenn sie den Patienten nicht gerade betäuben, können ihm nicht die leidvolle Last der Auseinandersetzung mit dem Sinn der Krankheit, des Lebens und des Todes nehmen.
„Im Kampf gegen den physischen Schmerz sind große Fortschritte gelungen; das Leiden der Unschuldigen und auch die seelischen Leiden haben in den letzten Jahrzehnten eher zugenommen. Ja, wir müssen alles tun, um Leid zu überwinden, aber ganz aus der Welt schaffen können wir es nicht – einfach deshalb nicht, weil wir unsere Endlichkeit nicht abschütteln können und weil niemand von uns imstande ist, die Macht des Bösen, der Schuld, aus der Welt zu schaffen, die immerfort – wir sehen es – Quell von Leiden ist“ (Spe salvi, N. 36).
Sogar ein materialistischer Philosoph wie Ludwig Feuerbach hat noch im 19. Jahrhundert die Bedeutung eines Zweckes, einer Hoffnung erkannt: „Nicht der Wille als solcher, nicht das vage Wissen, nur der Zweck, in dem sich die theoretische Tätigkeit mit der praktischen verbindet, gibt dem Menschen einen sittlichen Grund und Halt, d. h. Charakter. […] Wer einen Endzweck, hat ein Gesetz über sich: Er leitet sich selbst nicht nur; er wird geleitet. Wer keinen Endzweck, hat keine Heimat, kein Heiligtum. Größtes Unglück ist Zwecklosigkeit. Selbst wer sich gemeine Zwecke setzt, kommt besser durch, auch wenn er nicht besser ist, als wer keinen Zweck sich setzt“ (L. Feuerbach, Das Wesen des Christentums, Akademie, Berlin 1984, S. 129-130).
Es hat immer wieder Psychiater und Psychotherapeuten gegeben, die ein reduktionistisches Menschenbild kritisiert haben, und auf das Menschliche im Menschen hingewiesen und ein vollständigeres, personalistisches Menschenbild vertreten haben, wie z. B. Ludwig Binswanger, Igor Caruso, Rudolf Allers, Wilfried Daim und nicht zuletzt Viktor Frankl mit seiner Logotherapie und Existenzanalyse. Die Theorien dieser Autoren haben jedoch eine verhältnismäßig geringe Verbreitung gehabt, wahrscheinlich gerade weil sie nicht zum Zeitgeist passen.
Frankl betont: „Der Mensch ist nicht nur ein reagierendes und ein abreagierendes, sondern ein sich selbst transzendierendes Wesen. Und menschliches Dasein weist immer über sich selbst hinaus, weist immer auf etwas, das nicht wieder es selbst ist – auf etwas oder auf jemanden, auf einen Sinn oder auf ein mitmenschliches Sein. Erst im Dienst an einer Sache oder in der Liebe zu seinem Partner wird der Mensch ganz Mensch und ganz er selbst“ (Viktor Frankl, Die Sinnfrage in der Psychotherapie, Piper, München 1981, S. 38).
Die Bedeutung eines Lebenssinnes zu erkennen, ist sicher wichtig. Andererseits, auch wenn ein gemeiner Zweck besser ist als kein Zweck, kommt der Frage nach dem Wert des Zweckes eine zentrale Bedeutung zu.
Wilfried Daim hat versucht, den psychoanalytischen Begriff der Fixierung zu vertiefen: Fixierung wäre eine Art Vergötzung. Irgendetwas, eine Person, ein Gegenstand, eine Tätigkeit wird verabsolutiert, und nimmt im Leben eines Menschen eine, ihm nicht zustehende, zentrale Stelle ein. Die Überwertung des Fixierungsobjektes wird unvermeidlich zu Enttäuschungen und zu Versagen führen, weil ein solches Objekt nicht den erhofften Halt geben kann. Anstatt als Person zu wachsen, klammert sich der Mensch an das Fixierungsobjekt. Dadurch zerbricht die Integration der seelischen Prozesse, welche nach der Seite der Fixierung oder nach ihrem wahren Entwicklungsimpuls auseinanderklaffen (vgl. Wilfried Daim, Tiefenpsychologie und Erlösung, Herold, Wien 1954, S. 105).
Die Verabsolutierung eines endlichen Gutes bringt Unordnung in das ganze psychische Leben. Es werden falsche Prioritäten gesetzt und das, was eigentlich in die Mitte der Person gehört, bekommt nicht die richtige Anerkennung.
Der Mensch strebt jedoch nach dem Absoluten. Die Fixierung an ein endliches Gut verursacht eine innere Unzufriedenheit und das Bedürfnis nach Erlösung. Der Mensch kann unter der Anleitung des Psychotherapeuten die eigenen Fixierungen erkennen und den Fixierungsobjekten einen adäquaten Platz einräumen. Diese psychotherapeutische „Erlösung“ jedoch „hebt die Notwendigkeit einer metaphysischen nicht auf, erhält vielmehr von ihr aus erst ihren letzten Sinn und ihre volle Gültigkeit und Rechtfertigung“ (W. Daim, zit., S. 220).
Der Psychotherapie kann eine wichtige Aufgabe zukommen: Die Befreiung von Fixierungen kann die Persönlichkeit reifen lassen. Die Vergänglichkeit endlicher Güter zu erkennen, bietet die Möglichkeit, den Weg für eine aufrichtige Suche nach dem Absoluten zu ebnen.
Die Reflexion über die Enzyklika Spe salvi kann auch dem Psychotherapeuten dabei helfen, die eigenen Fixierungen zu überwinden. Sie kann auch dazu beitragen, den Sinn der eigenen Tätigkeit zu finden, nämlich die Begleitung der Patienten auf der Suche nach dem wesensgemäß echten Sinn der eigenen Existenz. Eine Begleitung, die sich oft als schwierig erweist, die Höhen vielleicht noch häufiger Tiefen verzeichnen lässt, die keinen Erfolg nach menschlichem Ermessen garantieren kann. Doch bei all diesem wird sie auch von der Hoffnung getragen, dass die therapeutische Intervention nicht nur ein technischer Eingriff am Patienten geblieben ist, sondern auch Teilnahme am Leiden, an den Ängsten und Sorgen eines Mitmenschen darstellt und Hoffnungen erwecken kann.
„In der Gemeinschaft der Seelen wird die bloße Weltzeit überschritten. An das Herz des anderen zu rühren, ist nie zu spät und nie vergebens. So wird ein wichtiges Element des christlichen Begriffs von Hoffnung nochmals deutlich. Unsere Hoffnung ist immer wesentlich auch Hoffnung für die anderen; nur so ist sie wirklich auch Hoffnung für mich selbst“ (Spe salvi, N. 48).
[Der Autor ist klinischer Psychiater und Dozent für Psychologie an der Gustav-Siewerth-Akademie in Weilheim-Bierbronnen (D) und an der Theologische Hochschule Chur (CH)]